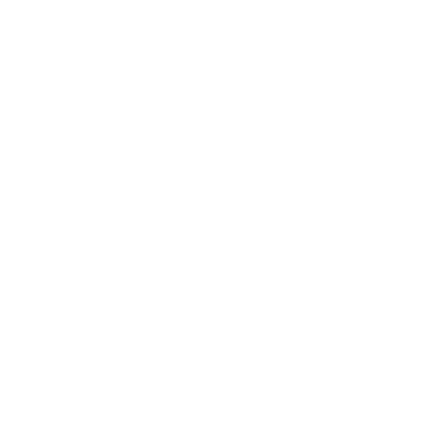Wie heisst die Sünde im 21. Jahrhundert?
- Lea Schubarth
- 5. Juli 2025
- 4 Min. Lesezeit
6. Juli 2025 Reformierte Kirche Bühl, Wiedikon

Foto: wikimedia.org
An einem ruhigen Sonntagmorgen fahren wir zu viert vom Lavaterhaus zur Bühlkirche in Wiedikon. Eine kleine Gruppe, weil ganz Zürich gerade Ferien macht. Wir unterhalten uns bald. Es geht um Rennvelos und Hörgeräte. Auch um eine Bibelpassage, in der mehrere Frauen sich zusammentun und bei Moses klagen, dass sie keinen Besitz erben können. Ein älterer Kirchengänger sagt, er habe die Bibel schon mehrmals gelesen, aber könne sich an diese Stelle nicht erinnern. Das habe ihn schockiert.
Dann schon die Kirche, neugotisches Hellrot vor blauem Himmel.
Drinnen probt der Chor und im Zimmer dahinter wird für den Kaffee nach dem Gottesdienst aufgetischt. Die Liedtexte verstehe ich nicht, weder akustisch noch inhaltlich. Später, während dem Gottesdienst, als wir alle das Reformierte Gesangbuch aufschlagen, denke ich, dass sie mir trotzdem gefallen.
Bevor der Gottesdienst beginnt, frage ich mich, wie lange er dauert, ob ich mich werde konzentrieren können, und erinnere mich an früher. Wie erfreut ich als Kind war über die Entdeckung des Däumchendrehens. Das konnte man gegen die Langeweile spielen. Ganz leise für sich und in den zu langen Ärmeln des Ministrantengewands, für niemand sichtbar. Mir fällt auf, dass ich eigentlich gar nicht weiss, worin sich die katholische und die reformierte Kirche unterscheiden. Unglaublich, wie viel man über etwas sprechen kann, das man nicht einmal ansatzweise verstanden hat.
Wie viele Leute wohl für den Gottesdienst auftauchen werden?
Langsam beginne ich zu schwitzen. Aber den Pulli auszuziehen fühlt sich irgendwie illegal an. Ich schaue mich um. Alle mit langen Ärmeln, ausser die Orgelpianistin, deren Schultern unbedeckt sind. Was heisst das nun für mich?
Die Glocken läuten.
Vorne fällt folgender Satz: «Ein Raum zum Atmen, ein Moment der Stille.» Gemeint ist etwas Spezifisches, das ich nicht verstanden habe, aber wahrscheinlich wohl einfach Gott und die Beziehung zu ihm, die im Alltag einen Freiraum schafft. Eine Chance, sich nicht mit sich selbst zu beschäftigen. Sich umzuschauen, zu sehen: die vergilbten Zahlentafeln, die die zu singenden Lieder anzeigen, das raue Polster der Bänke, farblich passend zum Gesangbuch. Die demütig gesenkten Köpfe der hier versammelten Kirchgemeinschaft, die verschiedenen Schuhmarken, die sie tragen (Onitsuka, Converse, Adidas, Geox). Das Durchschnittsalter zu errechnen. Sich zu fragen: Ist es diese Ruhe, die es mir erlaubt, mich hier so wohlzufühlen, wie ich es tue? Ja, so ist es, denke ich, und ich denke auch, vielleicht sollte ich wieder regelmässig in die Kirche gehen, und weiter, das muss so dumm klingen: in den Gottesdienst gehen, um mal abzuschalten.
Trotzdem erinnert mich der Gottesdienst an eine Meditation. Momente der Präsenz, der Klarheit, der Einheit von Körper und Geist im Jetzt. Dann Momente der Langeweile, etwa (oder vor allem) während aus dem Lukas-Evangelium gelesen wird. Darauf ein Abschweifen des Geistes, hin zu anderem: Einkaufsliste, Knurren im Bauch, Streit mit dem Vermieter, wo habe ich mein Velo hingestellt? Das Hirn bleibt irgendwo hängen, es drängt sich eine Sexszene auf, und eine weitere. In Gottes Haus? Schande. Und Klassiker.
«Fehler sind erlaubt, aber Schuld geht tiefer. (...) Was heisst es also, wenn ich sage, ich bin schuldig?»
Die Predigt holt mich in die Gegenwart zurück. Ich lerne, dass Reue eine Kombination aus Feststellung des eigenen Fehlers und der Verantwortung ist, die man dafür übernimmt. Ich lerne, dass wir oft auf der Seite derer stehen, die selbst kränken, selbst Täterinnen und Täter sind. Ich lerne weiter, dass der postmoderne Mensch sein Fehlverhalten auf Systeme, Prägungen und Sozialisierung schiebt, was eine Zerstückelung der Verantwortung zur Folge hat. Dabei sollte Schuld nicht nur ein systemisches, sondern auch ein persönliches Phänomen sein. Das nehme ich irritiert zur Kenntnis, denke, dass es absolut stimmt und gleichzeitig überhaupt nicht. Ist es denn falsch, nach dem Wieso zu fragen? Ausserdem: Ist ein Weltverständnis, das die Freiheit des Menschen von Sünde in direkte Beziehung zu Gott stellt, nicht der Inbegriff eines Systems?
Tipps hat der Gottesdienst für alle. Diejenigen, die gekränkt wurden durch andere, sollen sich überlegen, wie viele Chancen sie geben möchten. Es gebe Sachen, die man nicht vergeben müsse. Überhaupt ist die Predigt auf ihre eigene Art erfrischend. Ich kenne Vergebung als etwas, das man anderen gewähren muss, um sie nicht weiter zu verletzen, wenn sie sich bereits schuldig fühlen für ihr Verhalten. Verantwortung wiederum ist eine Falle: Weist man sie von sich, stellt man sich in die Opferrolle. Nimmt man sich ihrer an, öffnet man anderen die Tür, um festzustellen, man sei ein schlechter Mensch. Anders heisst es hier: Verantwortung ist ein heilsamer Kontrollverlust. Oder: Verantwortung übernehmen für sein Fehlverhalten ist Mut zur Ehrlichkeit, ohne sofortige Rechtfertigung. Oder: Schuld ist kein Makel, sondern Teil des Menschseins, mit dem wir als Gemeinschaft umgehen können. Das finde ich sehr schlau.
Mir weniger verständlich: «Schuld bekennen ist kein moralischer, sondern ein geistlicher Akt.» Was soll denn der Unterschied sein?
Wir sprechen gemeinsam das Vater Unser. Wir heiligen seinen Namen, bitten um täglich Brot, um Vergebung und die Kraft, unseren Schuldigern dasselbe entgegenbringen zu können.
Als Kind wünschte ich mir eine Armbanduhr, da ich ohne Uhr Angst bekam, der Gottesdienst könnte für immer weitergehen und es gebe ausserhalb der Wände der Kirche keine Welt.
Fast alle bleiben zum Kaffee.
Ich habe mir Fragen notiert: «Was sagen die Leute hier zu Alltagsproblemen, wenn man einen Rat braucht, etc.? Wenn es doch im Gesangsbuch heisst: ‹nicht durch Verdienst der Kreatur / Erbarmen ist’s, Erbarmen nur›. Wobei spielt Gott eine Rolle, wobei nicht? Wo verläuft die Grenze?»
Aber ich vergesse, zu fragen.
Stattdessen sprechen wir über Möglichkeiten, die Kirche jungen Leuten schmackhaft zu machen. Die Themen, sagt Pfarrerin Camichel, seien hochaktuell und beschäftigten auch die Jugend. Ja, sage ich, Schuld ist zeitlos. Aber mit dem Vokabular, fährt sie fort, könnten die Jungen nichts anfangen, Sünde und so ähnlich. Es brauche also eine Art Übersetzung. Wie heisst die Sünde im 21. Jahrhundert?
Lea Schubarth (*2003), JULL-Stadtbeobachterin seit 2023